«Morgen werde ich Hochstapler*in»
Über Super-Subjekte, Liebe – und eine Menge Arbeit


Eigentlich wollte ich Kunst- und Care-Bereich miteinander vergleichen und dabei etwas herausfinden über das Verhältnis von Liebe und Arbeit. In beiden Fällen wird un- oder schlecht bezahlte Arbeit gesellschaftlich legitimiert, indem behauptet wird, dass es sich dabei nicht um gewöhnliche Geldjobs handle, sondern um Arbeit aus Leidenschaft oder Liebe. Ich erinnere mich daran, dass eine Journalistin Christian Jankowski an der Pressekonferenz der Manifesta 11 fragte, warum er so viele unbezahlte Volunteers angestellt habe. Er antwortete, dass, hätte er die Leute bezahlt wie in normalen Geldjobs, dann hätten die Leute diese Arbeit wie einen normalen Job gemacht, und dann wäre auch die Manifesta 11 eine ganz normale Kunstausstellung geworden. In der Kunst arbeitet also demnach gut, wer dies aus Liebe und Leidenschaft tut. Und besser noch, ohne Lohn, weil man dann vergisst, dass man arbeitet?
Call It Love sollte den Ambivalenzen dieses Themas nachgehen: Was sind die geschlechterbezogenen Konnotationen, wenn schlecht bezahlte Arbeit mit Liebe legitimiert wird? Bedeutet die geforderte gesellschaftliche Anerkennung solcher Arbeit auch ihre gerechte Entlohnung? Oder verbergen sich in der Care-Arbeit und in der Kunst seltene Lebensbereiche, die sich der Kapitalisierung bislang erfolgreich entziehen? Konkreter: Was ist der Anteil von Care-Arbeit in der Kunst und umgekehrt? Wie könnten sich die Lebens- resp. Arbeitsbereiche stärker durchdringen und würde ein Nachdenken über Care nicht auch zu einem anderen Verständnis von Kunst führen?
Wenn eine Frage zur nächsten führt und die Dinge dazu tendieren allzu grundsätzlich zu werden, hilft es, mit einer Bestandsaufnahme zu beginnen. Und so entstand dieser bislang nicht abgeschlossene Fokus, der, ganz anders als geplant, nun bei Frauenquoten ansetzt und ganz unweigerlich auf Verhältnisse von Liebe, Care und Arbeit trifft.
30% Das Kunsthaus Zürich hat zwischen 2014 und 2017 Einzelausstellungen von 17 Künstlern und 2 Künstlerinnen gezeigt. Von den im Quoten Crash Test ausgewerteten Ausstellungsinstitutionen hat nur das Migrosmuseum auch eine trans-gender Künstler*in ausgestellt. Eine Rekordfrauenquote von 0% hat im gleichen Zeitraum die Fondation Beyeler. Der Schweizer Durchschnitt liegt heute bei rund 30%. Tendenz steigend.
ca. 50% Von den Leuten, mit denen ich mich über diese Zahlen und die wenig populäre Quotenfrage unterhalten habe, mag sich kaum jemand so recht für eine solche Regelungen, etwa bei Kunstpreisen, aussprechen. Die Gründe sind vielfältig. Es gibt überzeugendere oder weniger überzeugende. In der Juryarbeit der Kunstkommission der Stadt Zürich löst sich das Problem eleganterweise ganz von selbst, also ohne Quotenregelung. Erreicht wird der Ausgleich der Geschlechter allein dadurch, weil die Kommissionsmitglieder – Männer und Frauen – sensibilisiert sind für solche Fragen. Sie haben die Quoten verinnerlicht.
30% Komplizierter scheint der Falle bei den Swiss Art Awards. Die Eidgenössische Kunstkommission spricht sich kategorisch gegen eine Quotenregelung für Frauen aus. Weil das zu weit führen würde, so die Erklärung. Dann müsste man gerechterweise auch eine Quotenregelung für die Landessprachen und Kantone einführen. Also lieber gar nicht erst versuchen, die Schweiz angemessen zu repräsentieren. Der Frauenanteil ist bei den SSA bislang nicht über 30% gestiegen. Daran hat auch der hohe Frauenanteil in der Kommission nichts geändert.
< 2 Noch etwas anderes erfahre ich im Gespräch mit Lea Fluck, die nicht die Geschlechterverhältnisse, sondern die Kinder gezählt hat. Kaum eine Preisträgerin der vergangenen Jahre hatte mehr als ein Kind, anders ihre männlichen Kollegen, die oft 2 oder mehr Kinder haben. Man kann daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass es für eine mehrfache Mutter heute kaum möglich ist, sich erfolgreich um einen Kunstpreis zu bewerben (leider fehlen die Zahlen zu den Kinderzahlen der abgewiesenen Bewerberinnen), weil sie den Grossteil der Familienarbeit erledigt, und ihr kaum Zeit bleibt, um sich ihrer künstlerischen Arbeit zu widmen oder sich an Eröffnungen zu zeigen, bei denen sie ihre Arbeit angemessen bewerben kann. Väter hingegen scheinen von ihren Kindern kaum davon abgehalten, Kunstpreise zu gewinnen. Quotenregelungen sind wichtig. Sie schützen aber vor Chancenungleichheit nicht.
mehr Es braucht halt mehr Kitaplätze, mehr Putzpersonal für unsere Wohnungen und mehr gesundes Fastfood. Dafür spricht sich sogar die FDP aus. Frauen auf den Arbeitsmarkt! Männer auf den Arbeitsmarkt! Sport machen. Lebenslanges Lernen. Arbeiten. Fit bleiben. Uff. Die Kinder, Haus- und Carearbeit machen andere. Frauen mit weniger guten Ausbildungen und nicht selten mit Migrationshintergrund. Chancenungleichheit wird unter den Frauen neu verteilt, die Sorge umeinander ausgelagert und damit an die Kapitalisierung freigeben.
weniger Was sollen wir stattdessen tun? Weniger Lohnarbeit machen und Care- und Hausarbeit teilen. Die Dinge könnten so näher zusammenrücken. Care for work, work for care. Zumal die Sorge umeinander längst nicht auf Familienarbeit und Care-Berufe beschränkt ist. Gioia dal Molin beschreibt die ungleichen genderbezogenen Zuschreibungen, die sich durch das Berufsfeld der Kurator*in zieht: Der etwas autistische und assoziativ vorgehende, aber deshalb umso genialer arbeitende Starkurator ist demnach männlich konnotiert, die Kuratorin, die aus Leidenschaft handelt, ihr Hobby zum Beruf gemacht hat, und als liebevolle Gastgeberin auftritt, weiblich. Soweit die gesellschaftlichen Geschlechterzuschreibungen.
> 30 Jahre Harald Szeemann ist ein Auslaufmodell. Das wird spätestens dann klar, wenn Kuratorinnen wie Nadine Wietlisbach es sich zum Ziel setzen, die Produktionslogik ihrer Ausstellungen ihren eigenen Lebensumständen und denen von Künstler*innen anzupassen. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Eine Karriere muss nicht mit 30 Jahren auf dem Höhepunkt sein und darf auch von Krankheiten, Krisen oder aus anderen Gründen unterbrochen sein. Ein Museum muss nicht fünf Ausstellungen pro Jahr veranstalten. Ein*e Künstler*in muss nicht ein ganzes Museum mit seinen/ihren Werken füllen können.
Es ist Zeit für Quotenregelungen und für neue Ideen. Zum Beispiel Hochstapeln. Verena Doerfler erklärt die bislang verkannte und insbesondere männlich konnotierte Subjektivierungsform zur Überlebensstrategie für Frauen schlechthin und plädiert dafür, Selbstunternehmertum und -optimierung zu parodieren und zur Aufführung zu bringen. In politischer Absicht, versteht sich. Das schliesst aber natürlich nicht aus, dass sich damit auch einen Kunstpreis gewinnen lässt. Weitere Vorschläge bitte an die Redaktion!
Barbara Preisig

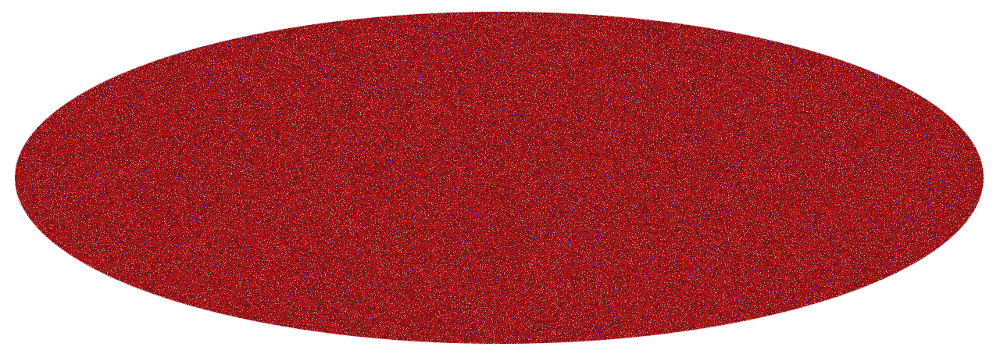


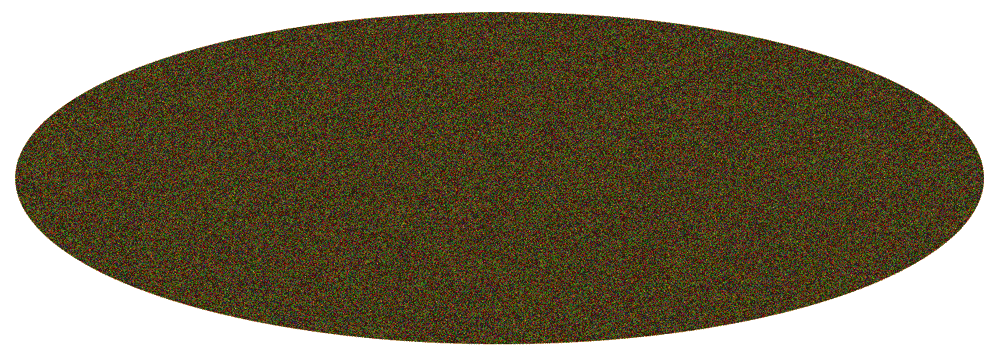
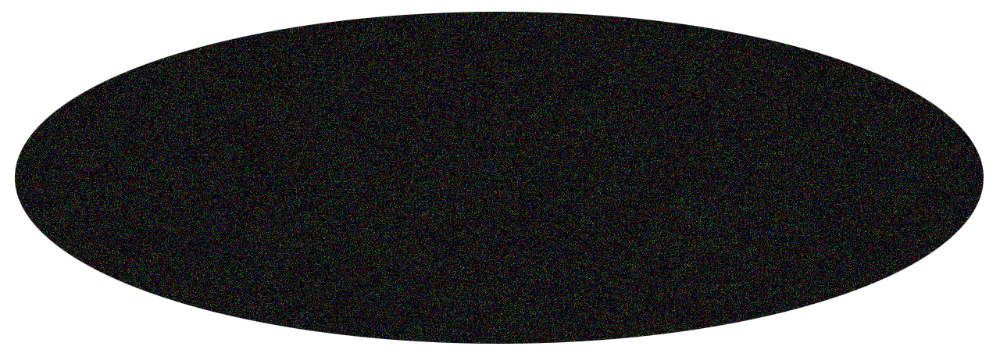
Das ist keine repräsentative Erhebung. Die Institutionen sind beliebig gewählt. Sie zeigen in der Zusammenstellung ein aktuelles Bild der Geschlechterverteilung im Schweizer Kunstbetrieb. Die Zahlen zu den Quoten bei Messebeteiligungen, Auktionen, Offspaces, Kunstgeschichtsprofessuren, Museumspersonal und Stiftungsräten stehen noch aus. Wer solche hat, soll sie uns schicken.